Christian Unverzagt
Die Kybernetische Zwischenwelt
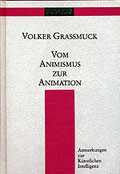
Zu Volker Grassmuck: Vom Animismus zur Animation. Anmerkungen zur Künstlichen Intelligenz. Junius-Verlag, Hamburg 1989
in: Fünfte Etappe, Bonn, Mai 1990
Im Nachglimmen des soeben abgeschalteten Bildschirms, wenn der Raum um einen herum sich erst wieder mühsam zur gültigen Realität aufpumpt, geraten Gedanken bisweilen in seltsame Taumel, und
unversehens findet man sich in geleugneten Denk- und Vorstellungszonen wieder. Ähnlich kann es einem bei der Lektüre von Volker Grassmucks Buch Vom Animismus zur Animation gehen. Dieser Effekt
dürfte keineswegs unerwünscht sein, will uns doch der Autor in jenes merkwürdige und von eigenen Regeln durchwaltete Zwischenreich einführen, das sich ohne Willen des Subjekts oder des Objekts
mit einem Mal zwischen beiden aufgetan hat.
In einem streckenweise wissenschaftsjournalistischen und dann wieder philosophisch-aphoristischen Abriß verfolgt der Autor, wie die Entwicklung des Wissens und der Maschinen ein Maschinenwissen
in Gang gesetzt hat, das unser modernes (Subjekt-) Bewußtsein bereits überholt haben könnte.
Der Mensch kann nicht mehr ohne die Schnittstellen zur Maschine leben, die ihn überall dort prothesenhaft verlängern, wo ihm seine autonomen Fähigkeiten abgeschnitten wurden. Diese Abhängigkeit
ist folgenreich, denn: „Nicht die Kontaktstelle bestimmt sich aus dem, was sie verbindet. Sondern die Etwasse, die sie kontaktiert, sind nur noch von ihr aus zu erkennen.“ Mensch und Welt werden
von dem Wissen geprägt, das beide lediglich in Beziehung setzen sollte. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist Wissen unter dem Paradigma der Information zunehmend zu einer abzählbaren Folge von
Ja/Nein-Entscheidungen geworden. Es kann in Maschinen ausgelagert werden und sich letztlich selbst verwalten. „Was vorher nur ein Verhältnis war, erlangt ein eigenständiges Sein.“ Information ist
zur Dritten Entität neben dem Menschen und seinen Objekten geworden.
Der Mensch selbst muß sich zu einem Geflecht von Informationen machen, wenn er sich noch äußern will. Nur noch im Zwischenreich der Informationen kann er mit den Dingen und den Anderen verkehren.
„Mit dem Programm, das wir der Maschine eingeschrieben haben, wendet sie sich jetzt an uns. Sie schreibt uns die Gebrauchsanweisung vor für die Anwendung der Fähigkeiten, die sie symbolisiert.“
Der Mensch braucht sich jedoch nicht als Sklave seiner ihm entfremdeten Produkte zu sehen; er ist ganz einfach zum Bewohner jener Sphäre geworden, die sich zwischen ihm und der Welt aufgetan hat.
Er selbst ist in-formierte Materie geworden. Medizinische Apparaturen haben ihn zu einem Aufschreibesystem gemacht, das seine Funktionen in digitalisierbaren Werten lesbar macht. Künftig darf er
sich als Wissen verstehen, das sich selbst (re-)generiert – und schon erfüllt er selbst die Anerkennungskriterien einer Künstlichen Intelligenz.
Von Turings Universalmaschine („gleichsam die platonische Idee des Computers“), die jede Maschine imitieren kann, über von Neumanns universelle Konstruktionsmaschine, die jeden beliebigen
Automaten (mithin auch ein Exemplar von sich selbst) herstellen kann, zu den künstlichen Paradiesgärten interaktiver, environ-mentaler Räume geht es in einem „kreisförmigen Drumherumreden“ (denn
das Zentrum des Labyrinths ist leer) immer wieder um das Projekt der KI-Forschung: ein selbständiges Gegenüber zu schaffen. Der moderne Mensch, der sich in seinen perfekten Produkten spiegeln
wollte, wird nur noch feststellen können, daß er ein anderer geworden ist als er dachte.
Bei Stichbohrungen in der Geschichte erweist sich das paradoxale Projekt als durchaus nicht neu. Bereits in den sprechenden Automaten, die Gerbert d’Aurillac (der spätere Papst Silvester II.),
Albertus Magnus oder Roger Bacon konstruierten, verschränken sich Wissen, Sprache, Maschine und Seele zu einer faszinierenden, aber auch beunruhigenden Synthese. Der plappernde Metallkopf des
Großen Albert soll ihm denn auch von seinem Schüler Thomas von Aquin zerschlagen worden sein. Zwischen Faszination an den Möglichkeiten eines gottgleichen Wissens und dem Entsetzen vor seinen
unkontrollierbaren Resultaten oszillierte die Haltung gegenüber den Mehr-als-Maschinen immer. Ob man den Golem oder ein Programm „zum Laufen gebracht“ hat, in beiden Fällen soll es die „Wahrheit“
des Wissens sein, die sich in den Geschöpfen manifestiert. Der Golem aber wird selbsttätig, indem er das ihm eingebrannte Zeichen der Wahrheit (’emeth) in Tod (meth) verwandelt. Kein Plan, und
erst recht kein Schöpfungsplan, ohne Kehrseite. Wahrheit und Tod, das sind denn auch die zwei Seiten jener Spielmarken, die immer im Einsatz waren, wenn es um die Schaffung schöpfungsmächtiger
Geschöpfe ging.
Der Golem selbst hat weder Sprache noch Seele, doch bald schon werden wir uns bei unseren Gegenübern dessen nicht mehr so sicher sein können. „Galt der Mensch als sprachbegabtes und damit
beseeltes Tier, so fragt der sprachbegabte Computer sich und uns, ob er nicht ebenso vernünftig und vielleicht sogar beseelt sei.“ Das berühmte Eliza-Programm simulierte bekanntlich nur eine
eigene Seele – um sich die der Sekretärin seines Schöpfers entdecken zu lassen. Wo liegt der Unterschied, wenn die Seelenäußerung der Effekt einer Maschinenvorgabe ist?
Den Horror der Ununterscheidbarkeit projiziert der Mensch noch in die Cyborgs, die kybernetischen Organismen, die in der Welt der Science-fiction ihr Un-Wesen treiben. Ob sie ihm bis in die Frage
nach der Unterscheidbarkeit gleichen? Bis in die ontologische Verunsicherung über sich selbst hinein? Ob beide am Ende bereits identisch sind, ohne es je merken zu können?
Sollte sich am Ende jene These glaubhaft machen können, die Volker Grassmuck als „die wohl schrecklichste“ bezeichnet? – „Nichts ändert sich.“
Aber das hieße zugleich auch: Alle kehren in der kybernetischen Zwischenwelt wieder, der Skeptiker und der Gläubige, der Schizoide und der Paranoiker, der Phantast und der Realist, der Rechner
und der Spieler und schließlich der Saboteur, der wie immer den Glauben hegt an den einen Knopf, der alles ausschaltet.
Jenseits des zwanghaften Entscheidungsdispositivs von Protagonisten-Propaganda oder Apriori-Ablehnung, die beide nicht zu den verbotenen Pforten der elektronischen Welt vorgedrungen sind, geht es
Volker Grassmuck um neue, an der Maschine selbst gewonnene Einblicke in die Welt der Computer; eine Welt, in der der Mensch nur noch mithalten kann, wenn er den Turing-Test besteht und sich im
Dialog mit der Maschine, letzlich dem künstlichen Menschen, beweist.
Es sind Ein-Blicke, die vielleicht am markantesten an den Aus-Blicken gewonnen werden. Ob nur, wie Volker Grassmuck im Anschluß an Kleists Marionettentheater spekuliert, die geistlosen Geschöpfe
das Paradies erreichen oder ob die neuen Schöpfer plötzlich backstage auftauchen, gerade noch rechtzeitig um zu sehen, wie die Bühnenarbeiter die letzte Staffage wegtragen, ist vielleicht nur
eine Frage der Interpretation. Zwischen Wahrheit und Tod, zwischen dem Paradies und der Apokalypse, ergibt sich „kein geschlossenes Gesamtbild“. Es bleiben nur „Optionen, die man zusammenbasteln
kann, wie ein Kind, das vor einem Scherbenhaufen ausprobiert, was paßt.“
Nachdem sich die ehernen Ordnungen der Dinge aufgelöst haben, sind die Möglichkeiten zwischen ihnen eingedrungen. Die Dinge liegen mit offenen Anschlußstellen da. „Die Wirklichkeit ist angefüllt
mit lnformationen, die ihren Gegenstand vergessen haben, mit Zitaten, deren Ursprung niemand mehr feststellen kann.“ Einzig Interpretationen, die die Möglichkeit ihres Gegenteils miteinbeziehen,
können noch einmal gültige Bilder von Wirklichkeit entstehen lassen. Es sind Muster in einem zweidimensionalen Raum, der mit dem der Wahrheit nichts mehr zu tun hat. Die Welt ist zur Fläche
geschrumpft, alle Tiefe ist nur eine Illusion auf der Oberfläche des Bildschirms. Nur indem man diese Oberfläche abwandert und dabei dem Zufälligen und Unerwarteten seine Chance gibt, lassen sich
Muster als Ergebnisse eines Spiels erkennen, das vor die Aufgabe gestellt ist, seine eigenen Regeln zu (er-)finden.
Vielleicht ist die Wiederkehr – oder die Permanenz – metaphysischer Muster einer der erstaunlichsten Effekte. Im Dialog mit der Maschine, in dem der Gegensatz von Subjekt und Objekt in listige
Metaloge gelockt wird, kehrt das alte Spiel der Metaphysik wieder; als Oberflächeneffekt, der sich im Durchspielen vorhandener Möglichkeiten auftut. „Die-Maschine-die-jede-Maschine-sein-kann“
versetzt uns in einen „metaphysischen Raum reiner Virtualität, der nur durch eine zusätzliche Anstrengung, durch eine Reduktion wieder verlassen werden kann.“ Diese Maschine erinnert an die
Vorstellung der Theologen, nach der Gott seine Unendlichkeit durch die Schöpfung reduzieren mußte, um sich zu offenbaren und um sich selbst in dieser Offenbarung zu erkennen. „Die
Universalmaschine hat für uns nur einen Sinn, wenn sie uns eine Maschine ist und nicht alle.“ Sie kann sich jedoch nicht selbst reduzieren, sie braucht uns zu ihrer „Offenbarung“. „Wir müssen die
reine Virulenz Der-Maschine-die-jede-Maschine-sein-kann reduzieren, damit für uns gewisse Muster erkennbar werden.“
Aleatorisch generiert erscheinen Muster, die dem referentiellen Denken der Theologie gleichen, die noch an einen von ihr unabhängigen Ort der Wahrheit glauben durfte. Aber wer ist wem gegenüber
wer? Die Maschine, die sich selbst schaffen kann, ist so schöpfungsmächtig wie ihr Schöpfer. Sie erzeugt ein Feld, in dem Mensch und Maschine über der Frage, wer sich nun wem angeglichen hat, zu
Interaktionspartnern werden.
Wollte klassische Metaphysik die letzten Gründe des Seins logisch verstanden wissen, so scheinen sich diese auf einmal zu verzeitlichen. Unversehens könnten die letzten Gründe jene gewesen sein,
mit denen künstlich-intelligente Expertensysteme unseren Untergang beschlossen haben. Vielleicht kommt es zu einer evolutionären Wachablösung, deren Sinn nur künstliche „Menschen“ erfassen
könnten. Der Mensch könnte zum Schöpfer jener apokalyptischen Macht geworden sein, die seine Epoche beschließt.
Die Metaphysik mag zufällig entstehen, als unwahrscheinliche, aber mögliche Verknüpfung im Netz; aber die Zufälligkeit ist selbst zur metaphysischen Größe unserer bis in den Nanosekundenbereich
berechneten Welt geworden. Der Zufall, der trotz aller Forschung an Zufallstheorien und -programmen jenseits der Berechenbarkeit bleibt, dringt in das Innere der Rechenmaschine als ihr Anderes.
Durch Hyperkomplexität entsteht jene labyrinthische Unüberschaubarkeit, die es unmöglich macht, ein System nachzubauen, das dasselbe Ein-/Ausgabeverhalten zeigt. Auch hier macht sich das Geschöpf
selbständig. Anders zwar als von der KI-Forschung intendiert, nämlich durch eher „dumme Zufälle“ – aber das war bei der Evolution der „natürlichen“ Intelligenz, die ihre zufälligen Mutationen dem
Selektionsdruck der Umwelt aussetzen mußte, nicht anders.
Es tut sich die Frage auf, wer sich künftig unter welchem Selektionsdruck beweisen muß: „Denken wird dann als das definiert sein, was den Turing-Test besteht.“ Das Denken, das sich auch im
Cyberspace zurechtfinden wird, ist auf dem Weg. Es geht nach einer Methode vor, die keine ist: der Unaufmerksamkeit, die das am Rande liegende als vorhandene Möglichkeiten entdeckt. Der Autor
selbst beschreibt sein Verfahren so: „unsystematisches Herumstöbern in Kybernetik, zeitgenössischer Literatur, Medizinlehrbüchern, Schallplatten, Bauanleitungen, Mailboxen, Kinofilmen,
Tageszeitungen, KI-Seminaren, Computerwerbebroschüren etc. etc. etc.“ Und neben die zeitgenössische Literatur, die Medizinlehrbücher, die Schallplatten, die Bauanleitungen, die Tageszeitung, die
Computerwerbebroschüren, als Hinweis in die Mailboxen und in die KI-Seminare gehört dieses Buch auch. Es ist nicht nur wegen der 16 schwarz-weiß Abbildungen, sondern vor allem durch seine Sprache
ein Bilder-Buch, das sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das Labyrinth der kommenden Zeit schlägt, uns in entlegene Kammern führt, über einigen anderen vielleicht nur einen
flüchtigen Namen entziffern läßt und dabei en passant einen bunten Zitatengarten anlegt. Es kann den Rechner zum Spielgefährten und das Denken zum Abenteuer werden lassen. Es animiert dazu,
Impulse in einem sich verflechtenden Netz weiterzugeben – das unsere Welt ist.

 Christian Unverzagt
Christian Unverzagt